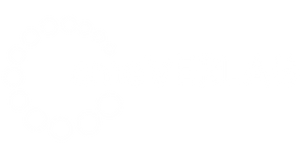Makulaödeme können die Sehkraft der Betroffenen erheblich beeinträchtigen. Eine rasche Diagnosestellung sowie eine konsequente und individualisierte Langzeittherapie können das Sehvermögen erhalten oder sogar wieder bessern. Allerdings stellt der demografische Wandel die augenärztliche Versorgung insbesondere in ländlichen Regionen vor enorme Herausforderungen. Moderne Therapieoptionen können helfen, auch zukünftig eine adäquate Behandlung zu ermöglichen. Erfahren Sie hier, welche Möglichkeiten moderne Wirkstoffe und individualisierte Therapieregime für die Behandlung bei Makulaödemen bieten und wie sie im Praxisalltag eingesetzt werden können.
Alle CME-Fortbildungen Ophthalmologie
Fortbildungen für Augenärzte: Lernen Sie mehr über Glaukom, Katarakt, Makuladegeneration, Diabetische Retinopathie und refraktive Chirurgie. Unsere CME-Kurse bieten aktuelle Erkenntnisse zu Lasertherapie, Netzhauterkrankungen und okuloplastischen Eingriffen – online, kostenlos und zertifiziert.

CME-Lounge Kardiologie – Update vom ESC aus Mailand
Jetzt kostenlos anmelden
Update Impfen – Aktuelle Empfehlungen und neue Technologien
Jetzt kostenlos anmelden
CME-Lounge Diabetes Praxis und Leitlinien DDG Update
Jetzt kostenlos anmelden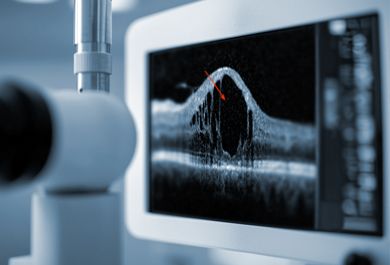
Diabetes und Auge – die Routine durchbrechen
Ein Diabetes mellitus geht mit zahlreichen makro- und mikrovaskulären Komplikationen einher. Auch das Auge kann betroffen sein: Das diabetische Makulaödem (DMÖ) ist eine der häufigsten Gründe für eine erhebliche Sehbeeinträchtigung bei Patienten im erwerbsfähigen Alter. Zahlreiche Therapieoptionen stehen zur Verfügung und können bei rascher und konsequenter Anwendung Seh- und Lebensqualität der Betroffenen langfristig erhalten. Dabei rückt aufgrund der Schlüsselrolle entzündlicher Mechanismen bei dieser Erkrankung neben der Anti-VEGF-Therapie (VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor) zunehmend auch die intravitreale Kortikosteroidtherapie in den Fokus. Erfahren Sie hier, wie häufig Augenuntersuchungen bei Diabetes erfolgen sollten, welche Therapieoptionen bei DMÖ bestehen und wie u. a. Biomarker eine individuelle Therapieplanung beeinflussen können.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Retinale Revolution? Biomarker und Bildgebung bei DMÖ und RVV
Makulaödeme als Folge einer diabetischen Retinopathie oder infolge eines retinalen Venenverschlusses zählen zu den häufigsten Ursachen für eine erhebliche Verschlechterung des Sehvermögens und können Arbeitsfähigkeit und Lebensqualität der Betroffenen stark beeinträchtigen. Pathophysiologisch entsteht das Makulaödem durch eine mittels Ischämie bedingte Freisetzung von Entzündungsmediatoren, die anatomische Veränderungen in der Netzhaut und eine erhöhte retinale Gefäßleckage hervorrufen, die gemeinsam das Sehvermögen beeinträchtigen können. Wichtig sind eine rasche Diagnosestellung sowie eine konsequente und individualisierte Therapie, um die Sehkraft der Betroffenen zu erhalten oder sogar wieder zu bessern. Erfahren Sie hier, wie nicht invasive Biomarker und künstliche Intelligenz (KI) zu frühzeitiger und präziser Diagnose sowie Therapieplanung und -kontrolle und so zum Sehkrafterhalt beitragen können.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Update zur Interstitiellen Zystitis
Die Interstitielle Zystitis (IC), respektive das Bladder-Pain-Syndrom (BPS), ist ein seltenes Krankheitsbild, das allerdings häufig mit einem hohen Leidensdruck bei den erkrankten Patienten einhergeht. Unterleibsschmerzen, Nykturie und Pollakisurie zwingen die meist weiblichen Betroffenen dazu, ihren Alltag und ihre Freizeit erheblich umzustellen beziehungsweise einzuschränken. Die genaue Ursache der Erkrankung ist jedoch bisher ungeklärt. Oft vergehen Jahre und verzweifelte Therapieversuche, bis die Diagnose gestellt wird. Ein früher Therapiebeginn ist jedoch für das klinische Outcome essenziell. Pentosanpolysulfat (PPS) ist als einzige Substanz für die Therapie der IC/BPS zugelassen. Weitere interventionelle und operative Verfahren stehen zur Verfügung, deren Wirksamkeit in urologischen Fachkreisen diskutiert wird. Die (supratrigonale) Zystektomie ist dabei als Ultima Ratio anzusehen.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Neue Wege in der medikamentösen Glaukomtherapie
Erstmals steht in der Glaukomtherapie seit über zwei Jahrzehnten mit den Rho-Kinase-(ROCK-)Inhibitoren wieder eine Substanzklasse mit einem innovativen Wirkmechanismus zur Verfügung. Beim Glaukom kommt es durch Aktivierung des Rho-Kinase-Signalweges zu morphologischen Veränderungen und einem zunehmenden Verlust der Elastizität und Kontraktilität des Trabekelwerkes. Dadurch erhöht sich der Abflusswiderstand, der Augeninnendruck (IOD) steigt. ROCK-Inhibitoren bieten erstmals die Möglichkeit, diesen glaukomatösen Veränderungen des Trabekelwerkes gezielt medikamentös entgegenzuwirken, den Hauptabflussweg des Kammerwassers über das Trabekelwerk zu verbessern und so den IOD zu senken. Mit einer Fixkombination aus einem ROCK-Inhibitor und einem Prostaglandinanalogon können aufgrund der komplementären Wirkeffekte beider Substanzen alle anterioren Abflusswege des Kammerwassers gleichzeitig verbessert werden. Erfahren Sie hier, welche Veränderungen des Trabekelwerkes bei Glaukom auftreten, welche Wirkeffekte ROCK-Inhibitoren bei Glaukom entfalten können und wie die Fixkombination Netarsudil/Latanoprost im klinischen Alltag eingesetzt werden kann.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Theorie und Praxis bei Makulaödem – ein Update
Makulaödeme können sowohl im Rahmen einer diabetischen Retinopathie als auch infolge eines retinalen Venenverschlusses auftreten. Sie sind die häufigste Ursache für eine vaskulär bedingte Visusminderung und können die Lebensqualität der Betroffenen erheblich beeinträchtigen. Betrifft das Makulaödem auch die Fovea, so stellt die intravitreale Therapie mit VEGF-Inhibitoren (VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor) das Mittel der ersten Wahl dar und kann die Sehkraft wieder erheblich steigern. Wichtig ist ein möglichst rascher und intensiver Start der Therapie sowie deren konsequente Fortsetzung. Anti-VEGF-Wirkstoffe mit verlängerter Wirkdauer und individualisierte Therapieregime können die Behandlungslast bei gleichzeitig gutem Visuserhalt deutlich reduzieren. Erfahren Sie hier, was zu Therapiebeginn und im weiteren Verlauf bei beiden Krankheitsbildern zu beachten ist und welche Ergebnisse mit dem seit Anfang 2024 in Deutschland zugelassenen Aflibercept 8 mg bei DMÖ erzielt werden können.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Diagnose der geografischen Atrophie – ein Update
Nach wie vor ist die altersabhängige Makuladegeneration (AMD) in Deutschland die Hauptursache für schwere Sehbeeinträchtigungen bis hin zur Erblindung. Die geografische Atrophie (GA), als Spätform der trockenen AMD, zeichnet sich durch atrophische Läsionen der Netzhaut aus, die sich mit individuell unterschiedlicher Geschwindigkeit bis hin zur Fovea ausbreiten. Für eine präzise Diagnosestellung der AMD/GA ist neben der Berücksichtigung von Risikofaktoren und visuellen Symptomen die multimodale Bildgebung unerlässlich. Neu identifizierte Biomarker helfen, das individuelle Progressionsrisiko abzuschätzen. Erfahren Sie hier, welche Risikofaktoren und visuellen Symptome bei der Diagnose einer AMD/GA berücksichtigt werden sollten und wie anhand multimodaler Bildgebung über die Diagnosestellung hinaus auch das Risiko für die Entwicklung und Progression einer GA abgeschätzt werden kann.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Therapie mit langen Intervallen bei Makulaödem – ein Update
Häufigste Ursache für eine vaskulär bedingte Visusminderung sind Makulaödeme. Sowohl als Folge einer diabetischen Retinopathie als auch infolge eines retinalen Venenverschlusses kann ein Makulaödem auftreten und das Sehvermögen der Betroffenen sowie auch deren Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Eine intravitreale Therapie mit VEGF-Inhibitoren (VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor) stellt in beiden Fällen bei Beteiligung der Fovea das Mittel der ersten Wahl dar und kann die Sehkraft wieder erheblich steigern. Wesentlich ist, dass die Therapie möglichst rasch und intensiv gestartet sowie konsequent fortgesetzt wird. Diesbezüglich kann mittels individualisierten Therapieregimen die Behandlungslast deutlich reduziert und gleichzeitig ein guter Visus erhalten werden. Erfahren Sie hier, worauf zu Beginn einer Anti-VEGF-Therapie zu achten ist, welche Unterschiede die verschiedenen Wirkstoffe aufweisen und wie mittels Treat and Extent (T&E) -Regime eingangs erzielte Visusgewinne bei gleichzeitig reduzierter Behandlungslast langfristig aufrechterhalten werden können.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Therapie der nAMD maßschneidern – Optionen für Intervallverlängerung und Therapieende
Die Einführung der Anti-VEGF-Therapie stellte eine Zeitenwende in der Behandlung der neovaskulären altersbedingten Makuladegeneration (nAMD) dar. Bei den meisten Patienten kann sie das Sehvermögen erhalten oder sogar verbessern. Wesentlich für den langfristigen Erfolg ist eine konsequente Anwendung der Therapie und eine dauerhaft gute Adhärenz der Patienten. Gefördert werden kann diese u. a. durch Therapieintervalle, die auf den individuellen Behandlungsbedarf abgestimmt sind. Wird Krankheitsstabilität erreicht, so stellt sich im klinischen Alltag die Frage nach dem weiteren Vorgehen: weiterbehandeln oder einen Auslassversuch wagen? Erfahren Sie hier, welche Möglichkeiten für eine Intervallverlängerung sich durch das Treat-and-Extend-(T&E-)Regime und die Verfügbarkeit verschiedener Anti-VEGF-Medikamente ergeben, welche Rezidivgefahr bei Therapieunterbrechung besteht und welche Möglichkeiten für ein kontrolliertes Therapieende erwogen werden können.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Behandlung von Augenerkrankungen mit topischen Kortikoiden
Topische Kortikosteroide sind und bleiben aufgrund ihres breiten Wirkspektrums, ihrer potenten Effektivität und ihres raschen Wirkeintrittes ein wichtiger Baustein im Armamentarium zur Behandlung verschiedener Erkrankungen des Auges. Sie haben entzündungshemmende, antiallergische und immunsuppressive Eigenschaften und sind in Form von Lösungen, Suspensionen, Salben und Gelen für die Behandlung entzündlicher Erkrankungen des Auges verfügbar. Lernen Sie hier die Unterschiede verschiedener Substanzen hinsichtlich Wirkstärke und -dauer kennen und erfahren Sie, wie topische Kortikosteroide bei unterschiedlichen Indikationen im klinischen Alltag erfolgreich eingesetzt werden können.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Therapieoptionen bei DMÖ und RVV – Status 2023
Sowohl das diabetische Makulaödem als auch ein Makulaödem nach retinalem Venenverschluss kann zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Sehkraft führen und die Selbstständigkeit und Arbeitsfähigkeit der Betroffenen deutlich einschränken. In beiden Fällen stellt die intravitreale Therapie mit VEGF-Inhibitoren (VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor) das Mittel der ersten Wahl dar und kann das Sehvermögen wieder erheblich verbessern. Wesentliche Voraussetzung ist – ebenfalls in beiden Fällen – ein rascher und intensiver Therapiebeginn sowie eine konsequente Fortsetzung der Therapie. Erfahren Sie hier, welche Komplikationen Patienten mit Diabetes am meisten fürchten, worauf zu Beginn einer Anti-VEGF-Therapie zu achten ist, wie sich die verfügbaren Wirkstoffe unterscheiden und welche Möglichkeiten eine langfristige Therapie im T&E-Regime für den Visuserhalt bei reduzierter Behandlungslast bieten kann.