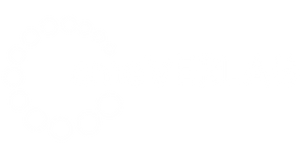Patienten mit einem Typ-2-Diabetes haben nicht nur ein hohes kardiovaskuläres, sondern auch ein hohes renales Risiko, die die Lebenserwartung der Betroffenen deutlich verkürzen. Im Laufe der letzten drei Jahrzehnte hat sich die Behandlung dieser Patienten aufgrund der Ergebnisse von großen klinischen Studien grundlegend geändert. Eine intensivierte Blutzuckereinstellung galt zusammen mit einer möglichst hoch dosierten Blockade des Renin-Angiotensin-Systems lange Zeit als einzige Option, um eine Albuminurie als Marker für die durch Diabetes bedingte Schädigung des glomerulären Filters signifikant zu reduzieren. Die Einführung der SGLT-2-Inhibitoren ermöglichte erstmals nicht nur die Senkung des kardiovaskulären Risikos, sondern auch die Reduktion relevanter renaler Endpunkte durch antidiabetisch wirksame Substanzen. Der nicht steroidale Mineralokortikoid-Rezeptorantagonist (MRA) Finerenon ist eine neue nicht antidiabetisch wirksame Therapieoption, mit der eine Reduktion des kardiovaskulären und renalen Risikos von Patienten mit einem Typ-2-Diabetes und mit chronischer Niereninsuffizienz mit Albuminurie dokumentiert werden konnte. Die Substanz kann in Kombination mit GLP-1-Rezeptoragonisten und SGLT-2-Inhibitoren verwendet werden. Die Serumkaliumkonzentrationen sind dabei regelmäßig zu überprüfen.
Alle CME-Fortbildungen Kardiologie
Kostenlose CME-Fortbildungen für Kardiologen: Erweitern Sie Ihr Wissen in koronaren Herzerkrankungen, Herzinsuffizienz, Bluthochdruck, Arrhythmien und interventioneller Kardiologie. Unsere zertifizierten Online-Kurse bieten praxisnahe Inhalte zu Echokardiographie, Herzklappenerkrankungen, kardialer Bildgebung, Prävention und Therapie aktueller kardiovaskulärer Erkrankungen. Bleiben Sie auf dem neuesten Stand der Forschung und sammeln Sie flexibel Ihre CME-Punkte – jederzeit abrufbar und kostenlos.

CME-Lounge Kardiologie – Update vom ESC aus Mailand
Jetzt kostenlos anmelden
Update Impfen – Aktuelle Empfehlungen und neue Technologien
Jetzt kostenlos anmelden
CME-Lounge Diabetes Praxis und Leitlinien DDG Update
Jetzt kostenlos anmelden
Focused Update – ESC-Leitlinie Herzinsuffizienz
Um den Ergebnissen aktueller Studien Rechnung zu tragen, hat die Europäische Gesellschaft für Kardiologie (ESC) ein Focused Update ihrer Leitlinien zur Herzinsuffizienz veröffentlicht. Bei der Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion (HFrEF) wird eine möglichst schnelle Initiierung aller vier Basismedikamente empfohlen. Bei der leicht reduzierten Ejektionsfraktion (HFmrEF) und der erhaltenen Ejektionsfraktion (HFpEF) haben aktuell nur Diuretika und Natrium-Glucose-Cotransporter-2-(SGLT2-)Inhibitoren Klasse-Ia-Empfehlungen. Der nicht steroidale Mineralokortikoid-Rezeptorantagonist Finerenon soll präventiv zur Verhinderung von Herzinsuffizienz-bedingten Hospitalisierungen bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und chronischer Nierenerkrankung (CKD) mit einer Klasse-Ia Empfehlung eingesetzt werden. Bei HFrEF-Patienten mit „worsening heart failure“ wird eine schnelle und frühzeitige Initiierung der medikamentösen Therapie empfohlen. Um das Risiko für weitere Hospitalisierungen zu senken, sollen verschiedene Wirkmechanismen additiv eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang wird Vericiguat als fünfter Baustein der Basistherapie empfohlen, die aus vier Basismedikamenten besteht (Eskalation zur Fünffachtherapie).
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Leitliniengerechte Therapie und neue Entwicklungen in der pulmonal arteriellen Hypertonie
Die pulmonal arterielle Hypertonie (PAH) ist eine Unterform der pulmonalen Hypertonie (PH). Die PAH stellt eine ernste und oftmals lebensbedrohliche Erkrankung dar. Dank zahlreicher klinischer Studien konnte die Behandlung der PAH in den letzten Jahren deutlich verbessert werden. Aufgrund der Seltenheit und der komplexen Natur der PAH sollte die Betreuung der Patienten in einem spezialisierten Zentrum in enger Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten erfolgen. Derzeit stehen mehrere Wirkstoffe zur Verfügung, die gemäß den aktuellen Leitlinien der European Society of Cardiology (ESC) und der European Respiratory Society (ERS) entweder als Monotherapie oder als Kombinationstherapie unter Berücksichtigung von individuellen Risikofaktoren und Begleiterkrankungen eingesetzt werden können. Eine ausführliche Differenzialdiagnostik mit Risikostratifizierung ist entscheidend, um eine individualisierte optimale Therapie zu ermöglichen.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Herzinsuffiziente Patienten mit AV-Klappenvitien identifizieren und zeitgemäß behandeln
Patienten mit einer Herzinsuffizienz und begleitenden AV-Klappenvitien benötigen eine leitliniengerechte medikamentöse Therapie. Diese besteht derzeit bei einer reduzierten Ejektionsfraktion aus der empfohlenen Vierfachtherapie und bei erhaltener Ejektionsfraktion aus der Gabe eines Natrium-Glucose-Cotransporter-2-Inhibitors (SGLT-2-Inhibitor). Die Herstellung einer Euvolämie ist bei allen Patienten obligat. In der Praxis gelingt die Umsetzung der Therapieempfehlungen oft nicht, was auch an den begleitenden Vitien liegen kann. AV-Klappenvitien sind prognoserelevant und sollten frühzeitig mit geeigneten echokardiografischen Verfahren morphologisch eingeordnet und quantifiziert werden, um die Prognose abschätzen zu können und die weitere Therapie zu planen. Dazu sollten die Patienten in spezialisierten Zentren vorgestellt werden. Durch aktuelle Evidenz konnte bestätigt werden, dass interventionelle Therapieverfahren zur Behandlung von AV-Klappenvitien nicht nur sehr effektive, sondern auch sehr sichere Behandlungsoptionen sind, um die Symptomatik der schwer kranken Patienten und deren Lebensqualität zu verbessern.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...
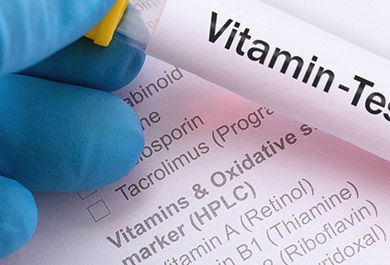
B12, B6, und Folsäure – Bedeutung der Trias für den Stoffwechsel
Die Trias der Vitamine B12, B6 und Folsäure muss gleichzeitig vorhanden sein, damit der Stoffwechsel in den Folat- und C1-(Methylierungs-)Zyklen ungestört vonstattengehen kann. Unterversorgung mit diesen Vitaminen kann zu erheblichen Defiziten bei den Synthesen der Nukleinsäure und Neurotransmitter führen und die Bildung und Instandhaltung der Myelinscheiden behindern. Zu den schwerwiegenden Folgen eines Mangels zählen eine gestörte Zellteilung sowie neurologische Defizite und Blutbildveränderungen. Die Häufigkeit der neurotropen Effekte eines B-Vitaminmangels und seine Ursachen werden vielfach unterschätzt. Die Therapie mit einer Vitaminkombination ist einfach und effektiv. Sie führt oft zu einer Verbesserung oder einem Verschwinden der Symptome. Die parenterale Therapie kann für Patienten, die aufgrund von Medikamenteneinnahme oder Resorptionsstörungen ein hohes Risiko für einen Vitaminmangel haben oder die von einer Langzeitwirkung profitieren, von Vorteil sein.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Adipositas und Komorbiditäten: Fokus Herz
Die Adipositas ist eine chronische Systemerkrankung, deren Definition sich in letzter Zeit grundlegend erweitert hat. Neben einem durch die starke Vermehrung des Körperfettes erhöhten Body-Mass-Index (BMI) liegen auch körperliche Beeinträchtigungen durch verschiedene Komorbiditäten vor, die mit einem hohen Risiko für Folgeerkrankungen assoziiert sind. Zur Pathophysiologie der Adipositas gibt es interessante Daten, die eine zentrale Störung des Essverhaltens belegen. Dadurch fällt es den Betroffenen schwer, die Erkrankung allein mit basistherapeutischen Maßnahmen zu kontrollieren. Die Diagnostik der Adipositas beschränkt sich nicht nur auf die Bestimmung des BMI, sondern bezieht ergänzende anthropometrische Maße und ein Staging körperlicher und mentaler Folgeerkrankungen mit ein, um das individuelle Risiko besser abschätzen zu können. Die Adipositasbehandlung ist deshalb weit mehr als nur eine Reduktion des Körpergewichtes. Die Inkretin-basierte Therapie stellt die derzeit wirksamste medikamentöse Option zur Gewichtsabnahme dar und bietet gleichzeitig die Chance für eine kardiovaskuläre Risikoreduktion.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Kardiale Amyloidose: Moderne Bildgebung und Therapie
Die systemische Amyloidose entsteht durch die Organablagerung fehlgefalteter Proteine, wobei die kardiale Beteiligung mit einer hohen Morbidität und Mortalität einhergeht. Obwohl lange als selten betrachtet, deuten aktuelle Daten darauf hin, dass die kardiale Amyloidose regelmäßig auftritt. Die kardiale Magnetresonanztomografie (Kardio-MRT) bietet eine detaillierte Gewebecharakterisierung und ermöglicht u. a. durch die Bestimmung von Extrazellularvolumen (ECV) und Late Gadolinium Enhancement (LGE) eine differenzierte Erfassung der kardialen Beteiligung und Funktion. Eine Zuordnung des Amyloidosesubtyps allein auf Basis der Kardio-MRT ist jedoch derzeit nicht möglich. Dennoch spielt die Kardio-MRT eine zunehmend wichtige Rolle in der Differenzialdiagnostik bei Verdacht auf eine kardiale Amyloidose. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Kardio-MRT ist ihre Fähigkeit, wertvolle prognostische Informationen zu liefern. Sie ermöglicht eine differenzierte Einschätzung des Krankheitsverlaufes, etwa durch die Ermittlung von LGE- und ECV-Veränderungen. Mit der Entwicklung neuer spezifischer Therapien für diese Transthyretin-Amyloidose (ATTR-Amyloidose) wird die Kardio-MRT zunehmend wichtiger als bildgebender Biomarker für das Therapiemonitoring und ermöglicht somit eine bessere Therapiesteuerung.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Wie befunde ich ein Kardio-CT? Eine strukturierte Schritt-für-Schritt-Anleitung
Die Kardio-CT besitzt aufgrund ihres hohen negativen prädiktiven Wertes für die koronare Herzerkrankung einen hohen Stellenwert in der Diagnostik der koronaren Herzerkrankung. Die Auswertung der koronaren CT-Angiografie beinhaltet dabei die Rekonstruktion am Scanner, die Darstellung im Viewer und schließlich die Auswertung im Informationssystem. Für optimale Rekonstruktionen spielen mehrere Aspekte eine Rolle, insbesondere die Auflösung, der Kernel und der Zeitpunkt im Herzzyklus. Hohe Herzfrequenzen und Arrhythmien können die Bildqualität negativ beeinflussen, wobei durch individuelle Anpassungen meist dennoch eine diagnostische Bildqualität erzielt werden kann. Die Darstellungsmöglichkeiten zur Befundung eines Kardio-CTs sind vielfältig, allerdings haben sich Modi herauskristallisiert, die als „Arbeitspferde“ der Diagnostik fungieren. Dies sind an erster Stelle die multiplanare Reformation, die es ermöglicht, kritische Stellen in mehreren Ebenen zu betrachten, sowie die gekrümmten Reformationen, die eine gute Übersicht bieten. Dreidimensionale Darstellungen sind eher zur Befunddemonstration geeignet. Der eigentliche Befundungsprozess kann in sieben Schritte gegliedert werden: Bildqualität, Koronaranomalie, koronarer Versorgungstyp, Stenosequantifizierung, Plaquebeurteilung, Nebenbefunde und Gesamtbeurteilung. Hier ist ein strukturiertes Vorgehen unabdingbar, um eine hohe diagnostische Qualität zu gewährleisten. Die abschließende Beurteilung erfolgt mithilfe der CAD-RADS-Klassifikation.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Praxiswissen: Diabetes und Multimorbidität – Teil 1
Die Prävalenzraten von Übergewicht und Typ-2-Diabetes nehmen in Deutschland weiter zu. Bei der Mehrzahl der Betroffenen geht der Typ-2-Diabetes mit weiteren Komorbiditäten einher, die zusammenfassend als Metabolisches Syndrom bezeichnet werden. Ein längerfristig unbehandelter oder unzureichend eingestellter Typ-2-Diabetes kann ernste Folgeerkrankungen nach sich ziehen. Im vorliegenden ersten Teil der Fortbildung werden neben wichtigen epidemiologischen Daten die Risikofaktoren für die Entstehung eines Typ-2-Diabetes beleuchtet. Besonderes Augenmerk gilt den Folgeerkrankungen Retinopathie, Nephropathie, Neuropathie, Gastroparese und diabetisches Fußsyndrom. Zudem werden aktuelle Empfehlungen für ein Diabetes-Screening sowie das leitliniengerechte Vorgehen zur Einstellung von Blutzucker, Triglyceriden, Cholesterin und Blutdruck vorgestellt. Hier geht es zum Teil 2 der Fortbildung: <a href="https://www.cme-kurs.de/kurse/praxiswissen-diabetes-und-multimorbiditaet-teil-2/">Praxiswissen: Diabetes und Multimorbidität – Teil 2</a>
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Medizinische Anwendungen von inhalativem Stickstoffmonoxid (iNO)
Die Bedeutung und Wirkungsweise von Stickstoffmonoxid (NO) als Botenstoff im Organismus von Säugetieren wurden in den 1980er-Jahren aufgeklärt. Inhalativ appliziertes NO verringert im Gegensatz zu intravenösen Vasodilatatoren den pulmonal vaskulären Widerstand nur in belüfteten Lungenarealen und verbessert dadurch die Oxygenierung. Inhalatives NO (iNO) wird bei verschiedenen herzchirurgischen Eingriffen und in der Neonatologie eingesetzt, um bei einem pulmonalen Hochdruck die rechtsventrikuläre Funktion und die Oxygenierung zu verbessern sowie die Notwendigkeit von invasiveren Notfalltherapien zu verringern. Beim Atemnotsyndrom von Erwachsenen (ARDS) konnte zwar die Sterblichkeit der Patienten durch iNO nicht gesenkt werden, der Einsatz kann jedoch wegen der signifikanten Verringerung kritischer Hypoxämien gerechtfertigt sein. Durch ein regelmäßiges Monitoring der NO-, NO2- und O2-Konzentration sowie des Methämoglobinanteils im Blut können toxische Effekte und Nebenwirkungen der Therapie beherrscht werden. Einem Reboundeffekt wird durch das langsame Ausschleichen der iNO-Therapie entgegengewirkt.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Praxiswissen Nephrologie: Optimierung von Diagnose und Therapie der CKD
Die chronische Nierenerkrankung (CKD) stellt eine zunehmende Herausforderung für das Gesundheitssystem dar. Mit einer Prävalenz von etwa 13 Millionen Betroffenen in Deutschland und einer prognostizierten Entwicklung zur fünfthäufigsten Todesursache bis 2040 erfordert die CKD eine verstärkte Aufmerksamkeit nicht zuletzt in der hausärztlichen Praxis. Frühere Limitationen in der Therapie haben zu einer Vernachlässigung der CKD geführt, jedoch haben neue Behandlungsmöglichkeiten das Feld der Nephrologie signifikant erweitert. Aktuelle Leitlinien, sowohl in der Nephrologie als auch in der Allgemeinmedizin, bieten neue Ansätze für die Diagnose und Therapie. Der „Cardio-Kidney-Metabolic“-Ansatz unterstreicht die Bedeutung der CKD im Kontext anderer Erkrankungen wie Diabetes und Hypertonie. Eine effektive Bewältigung der CKD erfordert daher eine enge Zusammenarbeit zwischen Nephrologen, Hausärzten und anderen Fachrichtungen, um der steigenden Patientenzahl gerecht zu werden und innovative Therapieansätze optimal zu implementieren.