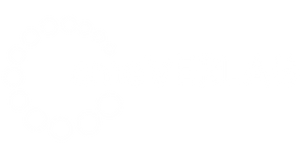Das Endocannabinoid-System ist bei der Entstehung und Aufrechterhaltung chronischer Schmerzen wesentlich beteiligt. Cannabis wird seit Jahrtausenden, cannabisbasierte Arzneimittel (CBA) seit einigen Jahrzehnten zur Behandlung verschiedener akuter und chronischer Beschwerden eingesetzt. Cannabinoide werden u. a. angewandt, um Schmerzen, Spastik, Schlafstörungen, Angstzustände, Übelkeit und Appetitlosigkeit zu lindern. Es besteht eine mäßige bis hohe Evidenz dafür, dass CBA bei einem Teil der Patienten mit chronischen Schmerzen zu einer wesentlichen Schmerzreduktion sowie zu einer Verbesserung der physikalischen Funktion und der Schlafqualität beitragen können. Die schmerzlindernde Wirkung scheint weitgehend unabhängig von der Schmerzursache zu sein. Dabei regulieren CBA vorzugsweise die stressassoziierte Schmerzverarbeitung. Innerhalb eines niedrigen Dosierkorridors können CBA in der Regel sicher eingesetzt werden. Diese Fortbildung bietet einen Überblick über die neurobiologischen Wirkmechanismen, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die klinische Evidenz zur medizinischen Anwendung von Cannabispräparaten. Dabei werden v. a. die Indikationen chronische Schmerzen und Spastik berücksichtigt.
Alle CME-Fortbildungen Schmerz
Erweitern Sie Ihr Wissen als Allgemeinmediziner mit unseren kostenlosen und zertifizierten CME-Kursen. Unsere Plattform bietet eine breite Auswahl an Fortbildungskursen, die speziell auf die Bedürfnisse von Hausärzten und Allgemeinmedizinern zugeschnitten sind. Ob Sie Ihre Kenntnisse in der Prävention, Diagnostik oder Therapie verschiedener Erkrankungen vertiefen möchten – unsere Kurse decken alle relevanten Themen der Allgemeinmedizin ab. Jeder Kurs ist akkreditiert und bietet Ihnen die Möglichkeit, CME-Punkte zu sammeln, die für Ihre berufliche Weiterbildung unerlässlich sind. Lernen Sie flexibel und online, wann immer es Ihnen passt, und bleiben Sie auf dem neuesten Stand der medizinischen Praxis. Starten Sie noch heute mit Ihrer Weiterbildung und profitieren Sie von hochwertigen Inhalten – kostenlos, zertifiziert und praxisorientiert.

CME-Lounge Kardiologie – Update vom ESC aus Mailand
Jetzt kostenlos anmelden
Update Impfen – Aktuelle Empfehlungen und neue Technologien
Jetzt kostenlos anmelden
CME-Lounge Diabetes Praxis und Leitlinien DDG Update
Jetzt kostenlos anmelden
Lumbaler Rückenschmerz: Leitlinien, Diagnostik und Therapie
Rückenschmerzen gelten als „Volkskrankheit“ und sind daher für nahezu jeden medizinischen Fachbereich relevant. Die Genese ist dabei äußerst vielfältig und häufig nicht einfach zu identifizieren. Neben dem Lebensstil und der mechanischen Belastung spielen auch genetische Faktoren eine wichtige Rolle, sodass nicht selten auch jüngere, sportliche Patienten betroffen sind. Das diagnostische und therapeutische Vorgehen sollte daher an die individuellen Voraussetzungen des Patienten angepasst werden. Die wichtigste Handlungsmaxime ist die Verhinderung einer Chronifizierung und der Entstehung irreversibler Folgezustände (z. B. Lähmungen nach Bandscheibenvorfällen). Diese Fortbildung setzt sich mit den aktuell geltenden Leitlinien des spezifischen und nicht spezifischen Rückenschmerzes auseinander. Dabei wird auf die häufigsten Auslöser sowie deren Pathophysiologie eingegangen. Zum Schluss wird ein Stufenschema zur Behandlung von akuten Rückenschmerzen vorgestellt.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Update: Diabetische Neuropathie erfolgreich diagnostizieren und therapieren
Etwa jeder dritte Mensch mit Diabetes ist von einer diabetischen Neuropathie betroffen. Diese kann die Lebensqualität der Betroffenen erheblich einschränken – vor allem durch quälende neuropathische Schmerzen, aber auch durch Missempfindungen oder Taubheitsgefühl in den unteren Extremitäten. Die klinische Untersuchung ergibt neuropathische Defizite (Zeichen) wie Reduktion oder Verlust der Berührungs-, Druck- oder Vibrationsempfindung, die eindeutige Prädiktoren für die Entstehung von Fußulzera und erhöhter Sterblichkeit sind. Fußulzera wiederum erhöhen bei Diabetespatienten die Morbidität und Mortalität erheblich. Trotz potenziell schwerwiegender Folgen wird die diabetische Neuropathie in Deutschland häufig nicht diagnostiziert und nicht therapiert. Daher sollten Diabetespatienten regelmäßig einem Screening auf das Vorliegen einer diabetischen Neuropathie zugeführt und frühzeitig behandelt werden. Die Therapie der diabetischen Neuropathie basiert auf den drei Säulen kausale Therapie, pathogenetisch orientierte Therapie und symptomatische Schmerztherapie. Ergänzend kommen nicht pharmakologische Maßnahmen zum Einsatz.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Vorderer Schulterschmerz
Der vordere Schulterschmerz ist ein häufig anzutreffendes Beschwerdebild. Betroffen sind oftmals Sportler, die Überkopfsportarten betreiben wie beispielsweise Handballer sowie Kraftsportler. Da der guten Funktionalität der Schulter im Alltag wie auch im Sport hohe Bedeutung zukommt, ist eine sorgfältige Anamnese und klinische Untersuchung wichtig, um die Ursache der Beschwerden abzuklären. Dabei ist die gesamte Funktionseinheit des Schultergürtels zu berücksichtigen - einschließlich dem Gleitlager, der Scapula und der Muskeln, die von der Scapula bis an den Ober- und auch Unterarm reichen. Die klinische Untersuchung sollte am freien Oberkörper erfolgen und stets im Seitenvergleich, wobei mit der gesunden Seite zu beginnen ist. Der Untersuchungsgang sollte standardisiert ablaufen, damit die Tests möglichst zeiteffizient sind und nichts übersehen wird. Die Behandlung erfolgt beim vorderen Schulterschmerz in aller Regel konservativ. Eine zentrale Rolle spielen physiotherapeutische Maßnahmen sowie eine adäquate Trainingsplanung. Die Injektion von Kortikoiden ist heutzutage nicht mehr als Standardtherapie anzusehen. Alternativ können Patienten von einer Behandlung profitieren, welche die Bildung antiinflammatorisch wirksamer Zytokine stimuliert und die Freisetzung von proinflammatorischen Zytokinen hemmt.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Diagnose und Therapie der chronischen Migräne
Die Prävalenz der chronischen Migräne variiert weltweit sehr stark. Schätzungen zufolge hat jeder 100 Mensch fast jeden Tag Kopfschmerzen und einen erheblichen Leidensdruck. Für die Therapie sind die richtige Diagnosestellung und somit die Abgrenzung von anderen chronischen Kopfschmerzen sowie der Ausschluss möglicher Ursachen wichtig. Bei chronischen Kopfschmerzen infolge eines Medikamentenübergebrauches muss die Akutmedikation abgesetzt werden. In der Prophylaxe der chronischen Migräne kommen zunächst verschiedene orale Wirkstoffklassen zum Einsatz. Allerdings sind deren Evidenz zur Wirksamkeit speziell bei chronischer Migräne schwach und die Adhärenz aufgrund von Nebenwirkungen oft schlecht. Bei unzureichendem Ansprechen kann Botulinumtoxin Typ A injiziert werden. Dessen Wirksamkeit wurde in Studien über mehr als zwei Jahre bei Patienten mit chronischer Migräne gezeigt. Sind diese Basistherapeutika nicht ausreichend wirksam, kann eine Eskalationstherapie mit monoklonalen Antikörpern erwogen werden.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Opioide in Schmerz- und Palliativmedizin – Bedeutung der evidenzbasierten patientengerechten Versorgung
Opioidanalgetika gehören zu den bedeutendsten pharmakotherapeutischen Optionen für die symptomatische Behandlung von Menschen mit akuten sowie chronischen Schmerzen unterschiedlichster Ätiologie, Pathogenese und Pathophysiologie. In der Tumorschmerztherapie spielen insbesondere die retardierten oralen Formen der µ-Agonisten Morphin, Oxycodon und Hydromorphon eine zentrale Rolle und bilden für viele Betroffene das pharmakologische Rückgrat einer effektiven und verträglichen Basisversorgung. Unterschiede in Wirksamkeit und Verträglichkeit dieser Substanzen beruhen nicht nur auf den pharmakologischen Eigenschaften, sondern stehen auch im Zusammenhang mit der jeweiligen Galenik. Diese nimmt nicht nur Einfluss auf Wirkeintritt, Wirkdauer und Wirkstärke, sondern beeinflusst auch die Sicherheit und Verträglichkeit und ist damit ein wichtiger Faktor für den Therapieerfolg. Die Verbesserung der individuellen Versorgung von Patienten mit Tumorschmerz auf Grundlage einer evidenzbasierten Medizin, die die Bedürfnisse Betroffener berücksichtigt und von der Erfahrung der behandelnden Ärzte profitiert, hat sich die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin (DGS) mit ihrer Praxisleitlinie Tumorschmerz (PLL-TS) bereits 2013 zur Aufgabe gemacht. Neben dem Primärziel einer verbesserten Versorgung von Schmerzpatienten will sich die PLL-TS explizit daran messen lassen, epidemiologisch nachvollziehbare Veränderungen zu bewirken. Die Praxisleitlinie Tumorschmerz wird gegenwärtig aktualisiert; künftig soll die prospektive Palliation und Patientenautonomie eine stärkere Gewichtung erhalten.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Schnell wirksame Fentanyle bei Tumordurchbruchschmerz
Tumorbedingte Durchbruchschmerzen (Breakthrough cancer Pain, BTcP) sind eine häufige Begleiterscheinung von Krebserkrankungen. Dennoch werden Tumordurchbruchschmerzen häufig unzureichend diagnostiziert, zumal viele Patienten nicht über das Ausmaß ihrer Beschwerden berichten. Dabei stellen die plötzlichen Schmerzattacken für die Betroffenen eine psychische und physische Belastung dar, die deren Lebensqualität stark einschränkt. Zudem verursachen Tumordurchbruchschmerzen erhebliche Kosten durch vermehrte Inanspruchnahme medizinischer Leistungen. In dieser Fortbildung erfahren Sie, was den typischen BTcP ausmacht, wie er sich erkennen und von anderen Schmerzformen wie dem „End-of-dose”-Schmerz abgrenzen lässt. Es werden die Behandlungsoptionen mit Opioiden für verschiedene Kategorien von Tumordurchbruchschmerzen vorgestellt. Besonders beleuchtet werden die schnell wirksamen Fentanyle, die als ideale Wirksubstanz zur Behandlung von tumorbedingten Durchbruchschmerzen gelten.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Therapie mit Opioiden bei chronischen Nichttumorschmerzen (CNTS)
Opioide sind Analgetika, die nicht nur bei tumorbedingten Schmerzen, sondern auch in der Langzeittherapie starker chronischer Nichttumorschmerzen (CNTS) eingesetzt werden. Für die Langzeittherapie starker chronischer Schmerzen wird eine regelmäßige orale Gabe stark wirksamer Opioide in retardierter Form empfohlen. Moderne Galeniken ermöglichen die nur einmal tägliche Dosisapplikation. Dieses Therapieschema verringert die Tablettenlast und kann so die Therapietreue der Patienten verbessern. Dank der niedrigeren Wirkstoffspiegelschwankungen wird eine konstante und zuverlässige Analgesie erreicht, Schmerzspitzen, Dosisendschmerzen und Nebenwirkungen treten seltener auf, die Schlafqualität der Patienten verbessert sich. Zudem reduzieren geringere Wirkstoffspiegelschwankungen das Risiko einer psychischen Abhängigkeit.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Rechtliche Hilfestellungen für die Cannabinoid-Verordnung zur Behandlung schwerkranker Patienten
Das am 10. März 2017 in Kraft getretene Gesetz zur „Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften“ (Cannabis-Gesetz) ermöglicht die Verordnung cannabishaltiger Arzneimittel zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Dabei sind gesetzliche Voraussetzungen zu erfüllen, wie das Vorliegen einer schwerwiegenden Erkrankung, nicht zur Verfügung stehende oder bereits ausgeschöpfte Standardtherapien oder wenn diese nach begründeter Einschätzung des behandelnden Arztes nicht zur Anwendung kommen können sowie das Vorliegen einer nicht ganz entfernt liegenden Aussicht auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende Symptome. Bei der ärztlichen Stellungnahme im Rahmen der Antragstellung für die Kostenübernahme der Cannabinoid-Therapie durch die GKV ist in diesem Zusammenhang insbesondere individuell auf die persönlichen Verhältnisse des jeweiligen Patienten einzugehen. In dieser Fortbildung erhalten Sie rechtliche Hilfestellungen für die Cannabinoid-Verordnung sowie für die Antragstellung auf Kostenübernahme der Cannabinoid-Therapie durch die GKV zur Behandlung schwerkranker Patienten. Darüber hinaus erfahren Sie, welche Möglichkeiten im Falle einer Antragsablehnung bestehen. Sie erhalten zudem Informationen zu der seitens des BfArM durchgeführten Begleiterhebung, zu deren Teilnahme Sie gesetzlich verpflichtet sind, sofern der Kostenübernahme zu Lasten der GKV stattgegeben wurde.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Die neue Praxisleitlinie Substitutionsbehandlung bei Opioidfehlgebrauch in der Schmerztherapie
Ein bis drei Prozent der Patienten mit einer Langzeitverordnung von Opioiden zur Schmerztherapie entwickeln einen „Fehlgebrauch“. Abhängigkeit und Suchtverhalten können die Folge sein. Die neue DGS-Praxisleitlinie „Substitutionsbehandlung bei Opioidfehlgebrauch in der Schmerztherapie“ widmet sich erstmalig diesem speziellen Problembereich. Opioide haben per se ein Gewöhnungs- und Suchtpotenzial. Allerdings gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen der physischen Abhängigkeit und Gewöhnung (Toleranz) und einer psychischen Abhängigkeit (Sucht). Die klinischen Zeichen einer Abhängigkeit und Sucht gehen mit einer Verhaltensänderung einher: Es steht nicht mehr die Schmerzlinderung bei der Einnahme des Opioids im Vordergrund, sondern das Erleben von Euphorie und das intensive, nicht zu unterdrückende Verlangen nach dem Opiat. Bei Anzeichen von „Fehlgebrauch“ ist die Diagnose Prescription Opioid Misuse (POM) zu stellen. Steht die Diagnose POM und ist die Entscheidung zu einem Therapiewechsel gefallen, kann der Einsatz eines Substitutionsmittels erwogen werden. Zur Substitution stehen heutzutage mehrere Substanzen zur Auswahl, die ihrerseits als Opioide in der Schmerztherapie Verwendung finden, sich aufgrund ihrer langen Halbwertszeit und aus pharmakologischen Gründen aber auch für kontrollierte Substitutionsbehandlungen eignen.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Interaktiv gegen den Schmerz - Falldiskussionen mit Experten aus Hämostaseologie, Schmerzmedizin und Orthopädie
Die Prävalenz von Schmerzen unter hämophilen Patienten ist hoch. Schmerzen entstehen häufig infolge von Blutungen in Gelenken und Muskulatur. Neben einer geeigneten Prophylaxe steht die Schmerzbehandlung für die betroffenen Patienten an erster Stelle. Anderenfalls droht eine systemische Funktionsstörung der gesamten Bewegungskette. Eine zielführende Schmerztherapie setzt eine geeignete Diagnostik voraus, z.B. mittels bildgebender Verfahren. Die Schmerztherapie bei Hämophilen muss immer differenziert erfolgen, da diese Patienten zusätzlichen Risiken ausgesetzt sind. Neben NSAR oder kurzzeitig eingesetzten <a href="/kurse/opioide-in-schmerz-und-palliativmedizin/">Opioiden </a>haben unterstützenden Maßnahmen eine hohe Bedeutung. Wenn diese Maßnahmen nicht zum Erfolg führen müssen chirurgische Interventionen in Betracht gezogen werden.