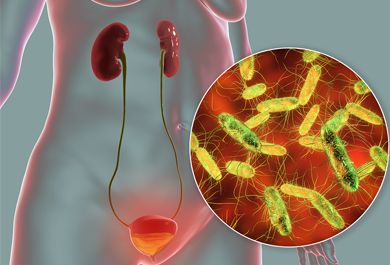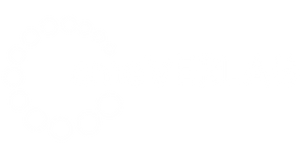Durch das Bakterium Escherichia coli oder den Sprosspilz Candida albicans ausgelöste einfache Harnwegsinfektionen sind häufig und folgen einem Ablauf komplexer mikrobieller Besiedelungsprozesse im Harntrakt, die zu einer Immunantwort des Körpers führen. Die Behandlung mit Antibiotika oder Antimykotika richtet sich nach dem Erreger, dessen Resistenzstatus sowie nach bestehenden Komorbiditäten des Patienten. Bei E. coli kommen meist Antibiotika wie Fosfomycin, Nitrofurantoin, Nitroxolin oder Pivmecillinam zum Einsatz, bei symptomatischen Candida-Harnwegsinfektionen Antimykotika wie Fluconazol oder Nitroxolin. Die Zunahme antibiotikaresistenter E. coli-Stämme und rezidivierender Infektionen erfordert einen verantwortungsvolleren Einsatz von Antibiotika, eine exakte Diagnostik und die Entwicklung multimodaler alternativer Therapiestrategien. Zur Reduktion des Antibiotikaverbrauches kommen prophylaktische oder therapeutische Ansätze infrage. Diese basieren u. a. auf pflanzlichen oder synthetischen Wirkstoffen zur Hemmung der Bakterienadhäsion an das Urothel – aber auch auf Immunisierungsstrategien und Probiotika.
Alle CME-Fortbildungen Gynäkologie
Erweitern Sie Ihr Wissen als Allgemeinmediziner mit unseren kostenlosen und zertifizierten CME-Kursen. Unsere Plattform bietet eine breite Auswahl an Fortbildungskursen, die speziell auf die Bedürfnisse von Hausärzten und Allgemeinmedizinern zugeschnitten sind. Ob Sie Ihre Kenntnisse in der Prävention, Diagnostik oder Therapie verschiedener Erkrankungen vertiefen möchten – unsere Kurse decken alle relevanten Themen der Allgemeinmedizin ab. Jeder Kurs ist akkreditiert und bietet Ihnen die Möglichkeit, CME-Punkte zu sammeln, die für Ihre berufliche Weiterbildung unerlässlich sind. Lernen Sie flexibel und online, wann immer es Ihnen passt, und bleiben Sie auf dem neuesten Stand der medizinischen Praxis. Starten Sie noch heute mit Ihrer Weiterbildung und profitieren Sie von hochwertigen Inhalten – kostenlos, zertifiziert und praxisorientiert.

CME-Lounge Kardiologie – Update vom ESC aus Mailand
Jetzt kostenlos anmelden
Update Impfen – Aktuelle Empfehlungen und neue Technologien
Jetzt kostenlos anmelden
CME-Lounge Diabetes Praxis und Leitlinien DDG Update
Jetzt kostenlos anmelden
Kontroversen in der Hormonersatztherapie
Peri- und postmenopausale Frauen leiden häufig unter klimakterischen Symptomen. Die Hormonersatztherapie (englisch „hormone replacement therapy“, HRT) stellt die effektivste Behandlung für akute und chronische klimakterische Beschwerden dar, dennoch ist sie nicht unumstritten und Gegenstand kontroverser Diskussionen. Die HRT ist die bevorzugte Erstlinientherapie für Frauen mit klimakterischen Symptomen. Hinsichtlich weiterer Auswirkungen auf die Gesundheit ist eine differenzierte Betrachtung erforderlich, da es sowohl eine Reihe von evidenzbasierten Vorteilen als auch Nachteilen gibt. Potenzielle Vorteile der HRT umfassen neben der effektiven Linderung klimakterischer Beschwerden und einer damit einhergehenden Verbesserung der Lebensqualität eine verbesserte metabolische und Knochengesundheit sowie eine möglicherweise insgesamt verlängerte Lebenserwartung. Diesen Vorteilen stehen jedoch mögliche Nachteile wie ein erhöhtes Risiko für Ovarial- und Brustkrebs sowie Thrombosen gegenüber.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Der unkomplizierte Harnwegsinfekt der Frau
Der unkomplizierte Harnwegsinfekt der Frau ist weitverbreitet. Etwa 9 % aller Mädchen und Frauen ab zwölf Jahren erleiden einmal im Jahr einen solchen Infekt. Gerade bei rezidivierenden Verläufen ist er häufig mit einem großen Leidensdruck der Betroffenen und zahlreichen antibiotischen Interventionen verbunden. Im Folgenden wird dargestellt, welche Harnwegsinfekte als unkompliziert zu betrachten sind, wie die diesbezüglichen Leitlinien zu interpretieren sind, wie diagnostiziert und wie im Akutfall, aber auch prophylaktisch behandelt werden kann. Dabei werden tiefere Einblicke in die Chancen und Limitationen der Diagnostik und der Behandlung unter besonderer Berücksichtigung der Pharmakologie, alternativer Strategien sowie klinisch praktischer Aspekte gegeben.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Migräne: Effektive Strategien der nicht-pharmakologischen Prophylaxe
Die Migräne ist eine komplexe primäre Kopfschmerzerkrankung. Sie ist für viele Patienten mit einem hohen Leidensdruck verbunden, der die Notwendigkeit effektiver Behandlungsstrategien unterstreicht. Neben der Akuttherapie ist die Prophylaxe von entscheidender Bedeutung. Eine multimodale Therapie, die sowohl medikamentöse als auch nicht-pharmakologische Ansätze umfasst, bietet die besten Chancen auf Anfallsreduktion. Evidenzbasierte nicht-pharmakologische Therapien zeichnen sich durch ihre Wirksamkeit, gute Verträglichkeit und Nachhaltigkeit aus und ermöglichen eine individuell angepasste Behandlung. Das Ziel aller nicht-medikamentösen Therapieformen ist es, die Häufigkeit von Kopfschmerztagen um mindestens 50% zu reduzieren, die Lebensqualität zu verbessern und das Risiko von medikamenteninduzierten Kopfschmerzen zu minimieren. Bei Patienten mit Migräne zeigt sich häufig eine Dysfunktion der mitochondrialen Energiegewinnung, was auf einen Mehrbedarf an Mikronährstoffen wie Magnesium, Riboflavin (Vitamin B2) und Coenzym Q10 hinweist. Studien belegen, dass eine gezielte Supplementierung dieser Nährstoffe im Rahmen einer orthomolekularen Prophylaxe Migräneattacken in ihrer Frequenz und Intensität signifikant verringern kann.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

C. diff.-Infektionen – Aktuelles für die hausärztliche Versorgung
Clostridioides difficile-Infektionen (CDI) gehen mit einer hohen Mortalitätsrate von 20 % einher. Dies gilt vor allem für rezidivierende CDI. Die finanzielle Belastung für das Gesundheitswesen ist erheblich. Eine der Hauptursachen ist ein übermäßiger und unsachgerechter Antibiotikagebrauch, da er die Darmmikrobiota schädigt und somit die Anfälligkeit für eine Besiedlung und Infektion mit pathogenen C. difficile-Stämmen erhöht. Der Erreger wird fäkal-oral über seine ubiquitär vorkommenden Sporen übertragen. Die von der vegetativen Form produzierten Enterotoxine sind für die typischen gastrointestinalen Symptome verantwortlich. Eine zentrale Maßnahme zur Reduktion der CDI-Inzidenz sind der rationale Antibiotikaeinsatz und Antibiotic-Stewardship-(ABS-)Programme. Diese zielen vor allem auf die Einschränkung des Einsatzes von Fluorchinolonen, Cephalosporinen und Clindamycin ab. Bei Verdacht auf CDI ist eine frühzeitige zweistufige Erregerdiagnostik essenziell. Der Einsatz eines spezifischen Engspektrumantibiotikums ist entscheidend, um eine weitere Schädigung der Darmmikrobiota und damit das Risiko für künftige Rezidive zu reduzieren.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Der unkomplizierte Harnwegsinfekt – erfolgreiche Therapie und Prophylaxe
Der unkomplizierte Harnwegsinfekt (HWI) ist in der Primärversorgung häufig anzutreffen. Der wichtigste Erreger ist Escherichia coli. Nicht antibiotische Behandlungsstrategien gewinnen immer mehr an Bedeutung. Dennoch bleibt die Antibiotikatherapie für viele Patienten die Behandlung der Wahl. Um die Wirksamkeit sicherzustellen, ist eine Kenntnis der aktuellen lokalen Antibiotikaresistenzlage unerlässlich. In Deutschland gelten aktuell Fosfomycin-Trometamol, Nitrofurantoin, Nitroxolin und Pivmecillinam als Antibiotika der ersten Wahl. Bevor bei rezidivierenden HWI eine prophylaktische Antibiotikagabe begonnen wird, sollten die Risikofaktoren für die Entstehung von Rezidiven berücksichtigt werden und nicht antibiotische Strategien ausgeschöpft sein. Bei vielen Patienten ist eine Candidurie nachweisbar. Der Nachweis von Candida im Urin stellt allerdings allein und ohne vorliegende Symptomatik keine Behandlungsindikation dar. Bei Patienten mit Harnkatheter und Candidurie reicht in vielen Fällen die Entfernung oder der Wechsel des Katheters zur Sanierung aus. Zur antimykotischen Therapie von gesicherten HWI mit Candida-Spezies steht eine Reihe wirksamer Antimykotika zur Verfügung.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Update: Antibiotika und das Mikrobiom – Die Praxis im Fokus
Antibiotika gehören zu den größten Errungenschaften der Medizin und retten jährlich unzählige Leben. Diese Fortbildung fokussiert sich auf einen oft übersehenen Teilaspekt: den Einfluss von Antibiotika auf das Darmmikrobiom, inkl. Nebenwirkungen und Resistenzen – Themen, die in der medizinischen Ausbildung bisher noch wenig Beachtung finden. Studien zeigen, dass selbst kurze Antibiosen die Mikrobiomfunktionalität nachhaltig verändern können, was besonders in der ambulanten Versorgung, in der die meisten Antibiotika verordnet werden, von Bedeutung ist. Durch diese Perspektive soll das Bild von Antibiotika nicht negativ gezeichnet, sondern ergänzt werden, um ihre Effektivität zu bewahren und Nebenwirkungen frühzeitig zu berücksichtigen.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Update Osteoporose: Prävalenz, Diagnostik und Therapie
Osteoporose ist eine systemische Skeletterkrankung, die mit einer abnehmenden Knochenmasse und einer mikroarchitektonischen Verschlechterung des Knochengewebes einhergeht, was zu einer erhöhten Brüchigkeit der Knochen und einem signifikanten Frakturrisiko führt. Im Jahr 2023 erfolgte durch den Dachverband Osteologie (DVO) eine umfassende Überarbeitung der S3-Leitlinie zur Diagnostik, Prophylaxe und Therapie der Osteoporose. Durch die Einführung eines neuartigen Frakturrisikomodells soll die erhebliche Behandlungslücke in der Versorgung von Patienten mit Osteoporose geschlossen werden. Um die Therapieadhärenz zu verbessern, sollten individualisierte Lösungen durch die Zusammenarbeit von Patienten, Angehörigen sowie Ärzten angestrebt werden. Patienten mit einem sehr hohen Frakturrisiko (=10 % über drei Jahre für Femur- und Wirbelkörperfrakturen) sollen primär mit osteoanabolen Präparaten behandelt werden. Hierfür sind die Wirkstoffe Teriparatid, Romosozumab und seit Dezember 2022 Abaloparatid zugelassen. Bei einer antiresorptiven Behandlung mit Bisphosphonaten und/oder Denosumab ist die seltene, aber ernste Komplikation einer Kiefernekrose zu berücksichtigen.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Infektionen und Harnsteine – von der Diagnostik zur richtigen Therapie
Harnsteine können sowohl Ursache als auch Folge von Harnwegsinfekten (HWI) sein. Der diagnostische und therapeutische Algorithmus ist jedoch unabhängig von der Entität weitgehend ähnlich. Einen hohen Stellenwert nimmt hierbei die Beseitigung der Obstruktion ein, da ein Harnaufstau eine Verschlechterung der Nierenfunktion und die Entstehung einer Urosepsis begünstigt. Kommt es dennoch zu einer Urosepsis, sind Procalcitonin (PCT) und Laktat wichtige Marker – sowohl für die Diagnostik als auch für das Therapiemonitoring. Therapeutisch sind darüber hinaus eine frühzeitige empirische Antibiotikatherapie und Flüssigkeitssubstitution indiziert. Aufgrund der zunehmend angespannten Resistenzlage müssen hierfür gegebenenfalls auch neuere Antibiotikakombinationen evaluiert werden.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...
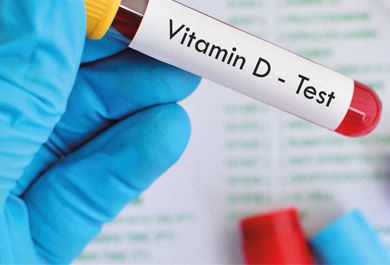
Vitamin-D-Mangel bei Risikogruppen – rationale Bestimmung und Substitution
Das sog. „Sonnenhormon“ Vitamin D erfüllt wichtige Funktionen in zahlreichen Organsystemen. Dabei ist Vitamin-D-Mangel insbesondere in den nördlicheren Breitengraden sehr verbreitet. Zahlreiche Studien postulieren Zusammenhänge zwischen Vitamin-D-Mangel und einer Vielzahl von Gesundheitsrisiken. Dazu gehören z. B. Typ-2-Diabetes, Depression und Brustkrebs. Bei nachgewiesenem Vitamin-D-Mangel wird stets eine bedarfsgerechte Vitamin-D-Substitution empfohlen. Bis dato ist eine Vitamin-D-Supplementation ohne nachgewiesenen Mangel für wenige Indikationen fest etabliert. Dazu gehören v. a. osteoporotische Frakturen. Bestimmte Populationen weisen ein erhöhtes Risiko für einen Vitamin-D-Mangel auf, z. B. ältere Menschen und Personen mit geringer Sonnenexposition. Zudem weisen Patienten und Patientinnen mit chronischen Erkrankungen des Verdauungstraktes, der Leber und der Niere häufig einen ungedeckten Vitamin-D-Bedarf auf. Es herrscht oftmals Unklarheit bezüglich Indikation und korrekter Durchführung einer Vitamin-D-Bestimmung und -Substitution. Ebenso ist der Stellenwert einer Kombination von Vitamin D mit anderen Mikronährstoffen nicht abschließend geklärt.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Vulvovaginale Mykosen und bakterielle Vaginose als häufigste vaginale Erkrankung
Infektionen der Vagina und der äußeren Geschlechtsorgane durch Hefepilze (vulvovginale Candidose, VVC) oder Bakterien (bakterielle Vaginose, BV) sind im klinischen Alltag an der Tagesordnung: Schätzungsweise drei von vier Frauen leiden mindestens einmal in ihrem Leben an einer vulvovaginalen Pilzinfektion und etwa 10 bis 15 % in Deutschland an einer BV (bei z. B. Afrikanerinnen sind es über 30 %). Ausgelöst oder begünstigt werden diese Infektionen durch eine Dysbalance des vaginalen Mikrobioms. Sie gehen mit einem hohen Leidensdruck für die Patientinnen einher und halten sich oftmals hartnäckig oder sind rezidivierend. Die BV geht zudem mit einem deutlich erhöhten Risiko für gynäkologische Komplikationen sowie Komplikationen während der Schwangerschaft einher und begünstigt Co-Infektionen mit sexuell übertragbaren Krankheiten. Erfahren Sie hier, welche Rolle das Mikrobiom bei diesen vaginalen Erkrankungen spielt, worauf bei deren Diagnosestellung zu achten ist und welche Therapien – ins besondere bei rezidivierenden Fällen – in aktuellen Leitlinien (auch während der Schwangerschaft) empfohlen werden.