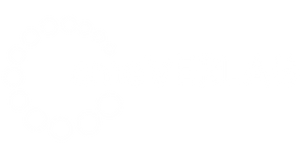Die meisten COPD-Patienten werden in hausärztlichen Praxen diagnostiziert und behandelt. Dabei sind Fehldiagnosen keine Seltenheit. Am häufigsten bereitet die Abgrenzung zu Asthma Schwierigkeiten. Das liegt zum einen daran, dass die Symptome sehr ähnlich sein können. Zum anderen existieren Mischformen beider Erkrankungen. Erfahren Sie, warum eine korrekte Diagnose für die optimale Behandlung von Asthma und COPD entscheidend ist und welche Bedeutung die Spirometrie dabei hat. Anhand von zwei Patientenfällen aus der Hausarztpraxis werden leitliniengerechte Herangehensweisen in der COPD-/Asthmadifferenzialdiagnostik veranschaulicht.
Alle CME-Fortbildungen Pneumologie
Aktuelle CME-Fortbildungen für Pneumologen: Lernen Sie mehr über Asthma, COPD, interstitielle Lungenerkrankungen, pulmonale Hypertonie und Schlafmedizin. Unsere zertifizierten Online-Kurse bieten praxisnahe Inhalte zu bronchoskopischen Verfahren, Lungenkrebs-Diagnostik und infektiösen Lungenerkrankungen – flexibel und kostenlos.

CME-Lounge Kardiologie – Update vom ESC aus Mailand
Jetzt kostenlos anmelden
Update Impfen – Aktuelle Empfehlungen und neue Technologien
Jetzt kostenlos anmelden
CME-Lounge Diabetes Praxis und Leitlinien DDG Update
Jetzt kostenlos anmelden
Allergische Rhinitis – Implikationen des Klimawandels
10 bis 40 % der Bevölkerung weltweit leiden unter den Symptomen einer allergischen Rhinitis. Der globale Klimawandel triggert über das Zusammenspiel mehrerer Faktoren, wie Temperaturerhöhung, ansteigende CO2-Konzentrationen, höhere Luftfeuchtigkeit und Luftverschmutzung durch Stickoxide, die Zunahme der Belastung durch Pflanzenpollen und Schimmelpilzsporen. Stickoxide können die Aggressivität der allergenen Proteine in Pflanzenpollen erhöhen. Die Behandlung der allergischen Rhinitis durch Allergenkarenz ist nicht immer möglich. Eine wirksame symptomatische Therapie kann durch orale und topische H1-Antihistaminika der zweiten und dritten Generation, durch topische Glukokortikoide, durch die Kombination beider Wirkstoffgruppen oder durch Leukotrien-Antagonisten erfolgen. Bei einer persistierenden allergischen Rhinitis mit schwerwiegender Symptomatik sind H1-Antagonisten zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnungsfähig. Eine kausale Behandlung mittels Allergenimmuntherapie (AIT) ist vor allem bei jüngeren Patienten anzustreben, um ein Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Optimierung der Inhalationstherapie bei COPD: Von der Theorie zur Praxis
Die Inhalationstherapie bei COPD ist komplex: Zahlreiche Medikamente und Inhalationsgeräte stehen zur Auswahl, aber Anwendungsfehler sind häufig und beeinträchtigen den Therapieerfolg. Die korrekte Technik ist entscheidend, um die Medikamente in die Lungenperipherie zu bringen, wo sie wirken sollen. Faktoren wie Partikelgröße, inspiratorischer Atemfluss und Geräteeigenschaften spielen eine wichtige Rolle bei der Auswahl des individuell passenden Inhalationssystems. Diese CME-Fortbildung bietet Einblicke in die optimale Inhalationstherapie bei COPD und zeigt, wie Anwendungsfehler reduziert werden können.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Fortschritte in der individuellen Therapie des nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms bei vulnerablen Patienten: Herausforderungen und Perspektiven
Lungenkarzinome stellen die zweithäufigste (Männer) bzw. dritthäufigste (Frauen) aller malignen Tumorerkrankungen in Deutschland dar: Davon handelt es sich bei etwa 85 % um nicht-kleinzellige Lungenkarzinome (NSCLC). NSCLC-Patienten sind häufig älter; das mediane Erkrankungsalter liegt bei etwa 69 Jahren. Die Therapieoptionen beim NSCLC sind in den letzten Jahren stetig gewachsen, die Therapieentscheidung wird damit zunehmend komplex. Wegweisend für den Einsatz zielgerichteter oder immunonkologisch fundierter Therapien ist die Testung auf Biomarker. Die Herausforderung: Die Patienten in der Praxis unterscheiden sich in der Regel von der in Zulassungsstudien untersuchten Population bezüglich Alter, Komorbiditäten und Allgemeinzustand. Einige Studiendaten zeigen jedoch, dass diese Faktoren maßgeblich die Verträglichkeit von Therapien beeinflussen können. Insbesondere ist die Anwendung von platinbasierten Chemotherapeutika im klinischen Alltag bei vulnerablen Patienten oftmals herausfordernd. Mit Ausnahme des Stadiums IA sind (kombinierte) Systemtherapien jedoch häufig erforderlich. Die Einschätzung von „Frailty“ (in etwa: Gebrechlichkeit) spielt eine kritische Rolle in der Therapieplanung, zumal Frailty sowohl tumorbedingt als auch unabhängig vom Tumor auftreten kann. Ein personalisierter Therapieansatz, unterstützt durch ein umfassendes geriatrisches Assessment, kann Nebenwirkungen von (platinbasierten) Chemotherapien verringern. Vor allem für ältere und alte Patienten, bei denen eine platinbasierte Kombinationstherapie nicht infrage kommt, bieten moderne Immuntherapien vielversprechende Optionen.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Medizinische Anwendungen von inhalativem Stickstoffmonoxid (iNO)
Die Bedeutung und Wirkungsweise von Stickstoffmonoxid (NO) als Botenstoff im Organismus von Säugetieren wurden in den 1980er-Jahren aufgeklärt. Inhalativ appliziertes NO verringert im Gegensatz zu intravenösen Vasodilatatoren den pulmonal vaskulären Widerstand nur in belüfteten Lungenarealen und verbessert dadurch die Oxygenierung. Inhalatives NO (iNO) wird bei verschiedenen herzchirurgischen Eingriffen und in der Neonatologie eingesetzt, um bei einem pulmonalen Hochdruck die rechtsventrikuläre Funktion und die Oxygenierung zu verbessern sowie die Notwendigkeit von invasiveren Notfalltherapien zu verringern. Beim Atemnotsyndrom von Erwachsenen (ARDS) konnte zwar die Sterblichkeit der Patienten durch iNO nicht gesenkt werden, der Einsatz kann jedoch wegen der signifikanten Verringerung kritischer Hypoxämien gerechtfertigt sein. Durch ein regelmäßiges Monitoring der NO-, NO2- und O2-Konzentration sowie des Methämoglobinanteils im Blut können toxische Effekte und Nebenwirkungen der Therapie beherrscht werden. Einem Reboundeffekt wird durch das langsame Ausschleichen der iNO-Therapie entgegengewirkt.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

COPD und Herz: Kardiovaskuläre Risiken medikamentös beeinflussen
Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) ist weltweit eine der Hauptursachen für Morbidität und Mortalität. Verlauf und Prognose der COPD werden von verschiedenen klinischen Faktoren beeinflusst, wobei Komorbiditäten eine wichtige Rolle spielen. Nahezu jeder COPD-Patient weist eine oder mehr als eine Begleiterkrankung auf. Kardiovaskuläre Erkrankungen, darunter koronare Herzkrankheit (KHK), Herzinsuffizienz und Arrhythmien, sind die häufigsten koexistierenden Krankheitsbilder bei COPD-Patienten und eine der Hauptursachen für die Mortalität in dieser Bevölkerungsgruppe. Sie werden wegen der sich überlappenden Symptomatik oft nicht erkannt. Zudem werden Medikamente häufig aus unbegründeter Sorge vor Nebenwirkungen zurückbehalten. Erfahren Sie u. a., wie Exazerbation und kardiale Ereignisse zusammenhängen und wie bei COPD eine Herzinsuffizienz in der Hausarztpraxis erkannt und behandelt werden kann.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

COPD-Exazerbationen: alle gleich? Geschlechtsspezifische Unterschiede
COPD-Exazerbationen stellen eine erhebliche Belastung für Patienten dar und sind mit einer Verschlechterung der Prognose, mit häufigen Hospitalisierungen und erhöhter Mortalität verbunden. Daher sollte die Prävention einer Exazerbation oberste Priorität haben. Aktuelle Erkenntnisse zeigen geschlechtsspezifische Unterschiede in der Prävalenz, Symptomatik und dem Exazerbationsrisiko. Besonders Frauen sind häufiger von Fehldiagnosen betroffen und weisen eine schlechtere Lebensqualität auf. Ein effektives Management umfasst die frühzeitige Diagnose, präventive Maßnahmen sowie individuell angepasste medikamentöse und nicht medikamentöse Therapien.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

COPD hat viele Gesichter – Phänotypen und deren Therapieableitungen
Die COPD zeigt viele Gesichter, und immer wieder wird versucht, diese als Phänotypen zu charakterisieren. Auch der aktuelle GOLD-Report schlägt einen Phänotyp-basierten Ansatz vor, der eine stärker personalisierte Behandlung erlaubt. In diesem Teil unserer COPD-Fortbildungsreihe stellen wir Ihnen das individuelle Vorgehen in Diagnostik und Therapie anhand von vier Patientenfällen vor. Es sind Fälle, wie sie in jeder Hausarztpraxis vorkommen können: Bei einem steht die Dyspnoe im Vordergrund, ein anderer klagt über Husten, und manchmal passen die Ergebnisse der Spirometrie nicht zu den Beschwerden. Erfahren Sie, welche Untersuchungsmethoden jeweils für Klarheit sorgen und welche Verfahren bereits frühe COPD-bedingte Schäden in den Atemwegen detektieren und quantifizieren können. Außerdem erhalten Sie Einblick in neue interventionelle Verfahren.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Individualisiertes Management der pulmonal arteriellen Hypertonie (PAH)
Dieser Artikel stellt die gezielte Therapie der pulmonal arteriellen Hypertonie (PAH), einer Unterform der pulmonalen Hypertonie (PH), vor. Die aktuellen Leitlinien der ESC/ERS zur pulmonalen Hypertonie haben die aus zahlreichen neuen Studien gewonnenen Erkenntnisse gesammelt, bewertet und den therapeutischen Algorithmus sowie die Empfehlungen für die Behandlung entsprechend angepasst. In dieser Fortbildung werden die neuen Richtlinien zur medikamentösen Therapie der PAH zusammengefasst und eingeordnet. Weitere Schwerpunkte liegen auf den überarbeiteten hämodynamischen Definitionen von PAH und den besonderen Aspekten in der Therapie der PAH bei Patienten mit Komorbiditäten. In den letzten Jahren hat sich die Behandlung der PAH dank zahlreicher Medikamentenstudien erheblich verbessert. Es stehen nun insgesamt elf PAH-Wirkstoffe zur Verfügung, die gemäß den neuen Leitlinien als Monotherapie oder in Kombinationstherapie unter Berücksichtigung von Begleiterkrankungen eingesetzt werden können. Da es sich bei PAH um eine seltene und komplex zu behandelnde Erkrankung handelt, sollten die Patienten in enger Zusammenarbeit mit den vor Ort behandelnden Ärzten in einem spezialisierten Zentrum betreut werden.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Langzeitsauerstofftherapie
Die Langzeitsauerstofftherapie (LTOT) verbessert die Prognose von Patienten mit verschiedenen pulmonalen Erkrankungen mit respiratorischer Insuffizienz. Pathogenetisch wichtig sind eine Verbesserung der Oxygenierung, eine mäßige Senkung des pulmonalarteriellen Druckes und insbesondere eine Verringerung der Atemarbeit. Die LTOT ist nur auf Grundlage einer ärztlichen Verordnung nach gründlicher Indikationsstellung mittels Blutgasanalysen gerechtfertigt. Patienten steht heute eine Vielzahl unterschiedlicher Sauerstoffsysteme für den häuslichen und mobilen Einsatz zur Verfügung. Flugreisen sind grundsätzlich möglich. Auch aufgrund der Vielfalt der LTOT-Systeme ist eine individuelle Einstellung des Patienten auf die LTOT erforderlich. Dies beinhaltet eine individuelle Sauerstofftitration und die Überprüfung der Triggerfähigkeit von Demand-Systemen. Die Auswahl einer geeigneten Sauerstoffversorgung muss die Situation des Patienten, seine Erwartungen und seine Therapieadhärenz berücksichtigen. Um den Behandlungserfolg zu gewährleisten, sollten Ärzte und Medizintechnikanbieter den Patienten detailliert über die Therapieform und die Anwendung des individuell gewählten LTOT-Systems aufklären und ihn engmaschig begleiten.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...
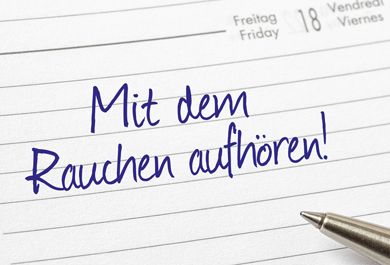
COPD – Risikofaktor Rauchen: Strategien zur Tabakentwöhnung
Rauchen ist der größte vermeidbare Risikofaktor für COPD, dennoch rauchen viele Menschen weiter. Fast die Hälfte der COPD-Patienten unternimmt ernsthafte Versuche, mit dem Rauchen aufzuhören. Dabei ist die Nutzung von E-Zigaretten nicht empfehlenswert. Diese Fortbildung bietet umfassende Einblicke in die gesundheitlichen Risiken des Rauchens und die Effektivität verschiedener Entwöhnungsstrategien. Besondere Aufmerksamkeit wird der Rolle von E-Zigaretten und den Herausforderungen bei der Tabakentwöhnung gewidmet. Erfahren Sie mehr über evidenzbasierte Ansätze und aktuelle Forschungsergebnisse zur Unterstützung Ihrer Patienten bei der Raucherentwöhnung.