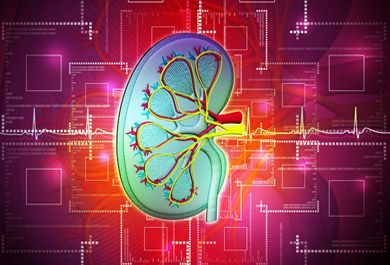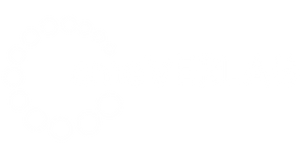„Chronic kidney disease“-assoziierter Pruritus (CKD-aP), auch bekannt als urämischer oder nephrogener Pruritus, beschreibt einen häufigen, oft unterschätzten Juckreiz, der bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz auftritt. CKD-aP ist mit einer verminderten Lebensqualität und einer erhöhten Sterblichkeit verbunden. Obwohl 58 % der Hämodialysepatienten in Deutschland unter CKD-aP leiden, wird das Problem viel zu selten erkannt und adäquat behandelt. Bei der Entstehung des CKD-aP spielt ein Ungleichgewicht peripherer µ- und κ-Opioidrezeptoren (MOR bzw. KOR) eine wichtige Rolle. Folglich lässt sich eine Linderung des Pruritus über MOR-Antagonisten bzw. KOR-Agonisten erreichen. Mittlerweile wurde der erste KOR-Agonist zur Behandlung des CKD-aP hierzulande zugelassen.
Alle CME-Fortbildungen Nephrologie
Erweitern Sie Ihr Wissen als Allgemeinmediziner mit unseren kostenlosen und zertifizierten CME-Kursen. Unsere Plattform bietet eine breite Auswahl an Fortbildungskursen, die speziell auf die Bedürfnisse von Hausärzten und Allgemeinmedizinern zugeschnitten sind. Ob Sie Ihre Kenntnisse in der Prävention, Diagnostik oder Therapie verschiedener Erkrankungen vertiefen möchten – unsere Kurse decken alle relevanten Themen der Allgemeinmedizin ab. Jeder Kurs ist akkreditiert und bietet Ihnen die Möglichkeit, CME-Punkte zu sammeln, die für Ihre berufliche Weiterbildung unerlässlich sind. Lernen Sie flexibel und online, wann immer es Ihnen passt, und bleiben Sie auf dem neuesten Stand der medizinischen Praxis. Starten Sie noch heute mit Ihrer Weiterbildung und profitieren Sie von hochwertigen Inhalten – kostenlos, zertifiziert und praxisorientiert.

Neuropsychiatrische Symptome beim idiopathischen Parkinson-Syndrom
Beim Morbus Parkinson können neben den motorischen Symptomen in allen Stadien der Erkrankung auch nicht motorische Symptome auftreten, die die Lebensqualität der Patienten teils erheblich beeinträchtigen. Unter ihnen spielen neuropsychiatrische Symptome eine wichtige Rolle. Weit verbreitet sind beispielsweise Tagesmüdigkeit/Fatigue, Angst, Depression und Demenz. Bei betroffenen Patienten steht oft zunächst die Optimierung/Anpassung der dopaminergen Therapie im Vordergrund. So gibt es bei Vigilanzstörungen/Tagesmüdigkeit einen Zusammenhang mit Dopaminagonisten – wobei sich die Vertreter der Wirkstoffklasse in dieser Hinsicht unterscheiden. Parkinson-Patienten mit Depression scheinen hingegen von Dopaminagonisten profitieren zu können. Zu weiteren Behandlungsmöglichkeiten nicht motorischer Symptome gibt es in der Regel aufgrund mangelnder Daten keine spezifischen Empfehlungen für Parkinson-Patienten. Sie orientieren sich an den allgemeinen Empfehlungen für die Therapie dieser Symptome. Darüber hinaus sind neuropsychiatrische Nebenwirkungen der dopaminergen Therapie wie halluzinogene Psychosen und dopaminerge Verhaltensstörungen bei der Behandlung von Parkinson-Patienten im klinischen Alltag von zentraler Bedeutung. Auch hier gibt es Unterschiede bei den Dopaminagonisten.
Am Ende dieser Fortbildung kennen Sie...

Hyperkaliämie Management – Update 2018
Die Hyperkaliämie ist eine häufige und lebensbedrohliche Elektrolytstörung bei Patienten mit chronischer Herz- und Niereninsuffizienz, die weitreichende Konsequenzen für das Therapiemanagement haben kann. Bereits innerhalb des Normbereichs leicht erhöhte Serumkaliumspiegel können bei den Betroffenen mit einer signifikant erhöhten Mortalität assoziiert sein. Ein besonders hohes Risiko für das Auftreten einer Hyperkaliämie besteht, wenn die Therapie der Grunderkrankung mit einem Inhibitor des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems (RAAS) erfolgt. Oftmals wird diese prognostisch bedeutsame Therapie zwecks Vermeidung einer Hyperkaliämie oder zur Senkung bereits erhöhter Serumkaliumwerte abgesetzt. Bisherige Therapiestrategien zur Behandlung der Hyperkaliämie eignen sich überwiegend für die kurz- bis mittelfristige Kontrolle der Serumkaliumspiegel. Neue innovative kaliumbindende Therapieansätze könnten nun auch langfristig die Kontrolle der Hyperkaliämie bewirken, während gleichzeitig die indizierte Therapie der Herz- und Niereninsuffizienz in der optimalen Dosis weitergeführt werden kann. Erste Studien dazu liefern bereits vielversprechende Ergebnisse.